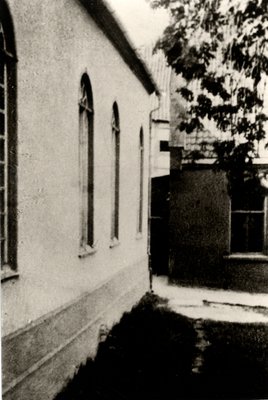Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde, der christlichen Gemeinden, der Stadt sowie Bürgerinnen und Bürger treffen sich in diesem Jahr am 10. November um 16 Uhr in der Osthofenstraße am Ort der einstigen Synagoge und gehen dann zum jüdischen Friedhof und zum Osthofenfriedhof. 2022 bietet der 200. Jahrestag der Weihung der Synagoge den Anlass zu einem Rückblick auf die Geschichte der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Soest.
Die Spuren jüdischen Lebens reichen zurück bis zur Frühzeit der Stadtkommune. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts sind Juden auch namentlich nachweisbar, und ihre Zahl wuchs. Das änderte sich, als ihnen die große Pest 1348/50 zur Last gelegt wurde und sie – wie überall im Reich – Opfer eines Pogroms wurden. Bis ins 16. Jahrhundert sind in Soest keine Juden nachweisbar; anschließend durften jahrhundertelang nur zwei – möglichste finanzstarke – Familien in Soest leben. Ihre Stellung war reguliert und blieb diskriminiert. Dauerhafte offene, gewaltsame Feindseligkeiten gab es nicht. Die wenigen Juden gehörten trotz sozialer Grenzen zur Soester Bevölkerung.
Ihre geringe Zahl verhinderte bis ins 19. Jahrhundert die Bildung einer Synagogengemeinde. Schulmeister wurden privat beschäftigt. Allerdings gab es schon Ende des 18. Jahrhunderts erste vorgemeindliche Strukturen, etwa eine Kasse, aus der auch Ausgaben für den Kultus und die Betstube bestritten wurden, die in einem Privathaus in der Thomästraße bestand.
Das 19. Jahrhundert brachte nach und nach die Emanzipation der Juden als Staatsbürger. Schrittweise fielen die rechtlichen Beschränkungen. Zahlreiche jüdische Familien zogen nach Soest. Schnell erwies sich der private Betraum als zu klein für die wachsende Gemeinschaft, und so errichtete man an der Osthofenstraße eine eigene Synagoge und ein Schulgebäude mit Lehrerwohnung. 1822 wurde sie eingeweiht und damit war eine Synagogengemeinde etabliert. Das Gebäude lag zurückgesetzt hinter einem Vorgarten und bot Raum für 200 Personen. 1882 wurde es renoviert und erweitert, 1929 folgte eine weitere Renovierung. Äußerlich war es schlicht gehalten, sein Innenraum aber aufwändig gestaltet und verziert.
Im 19. Jahrhundert wuchs die jüdische Gemeinde von 18 auf 292 Mitglieder. Das Miteinander verlief im Wesentlichen friedlich. Verbreitet saßen Juden im Stadtrat und nahmen am gesellschaftlichen Leben teil. Damit ist nichts darüber gesagt, ob die tief in Bewusstsein und Mentalität verankerte Judenfeindschaft verschwunden war. Reichsweit änderte sich deren Erscheinungsform: Zu den religiösen und wirtschaftlichen Motiven kam eine neue pseudowissenschaftliche Sicht hinzu, die biologistisch und rassistisch argumentierte und Juden als minderwertige „Mischlingsrasse“ diffamierte. Zugleich entstand ein Begriff für diese moderne Judenfeindlichkeit: Antisemitismus.
Äußerlich betrachtet schritt die Emanzipation fort. Im Ersten Weltkrieg kämpften und starben zahlreiche Soester Juden. Alles ganz normal? Keineswegs. Nach Kriegsende wetterte etwa der Direktor der Soester Blindenanstalt auf Versammlungen und in Leserbriefen gegen die „Juden als Fremdkörper im Staate“. Die Ortsgruppe des Deutschen Schutz- und Trutzbundes beklebt die Schaufenster jüdischer Geschäfte 1919 mit Hassparolen. Immerhin gab es aus der Mitte der Stadtgesellschaft auch offenen Widerspruch gegen solche Hetze.
Judenfeindliche Einstellungen waren verbreitet und die Nationalsozialisten konnten mit Erfolg daran anknüpfen. Antisemitismus bildete ihr zentrales ideologisches Bindemittel. Emotionen wurden geschürt und judenfeindliche Einstellungen zu Taten entwickelt. Mit der Machtübernahme griffen auch in Soest die Maßnahmen zur Entrechtlichung, Verdrängung und Vertreibung. In der Nacht vom 10. zum 11. November 1938 wurden während der Kirmes die Synagoge und die jüdische Schule in Brand gesetzt und zerstört. Zunehmend wurde Eigentum „arisiert“ und Druck zur Auswanderung ausgeübt, bis die letzte schreckliche Stufe der Radikalisierung einsetzte: Emigrationsverbot, Ghettoisierung, Deportation und schließlich Ermordung. Die in Soest verbliebenen 44 Juden wurden in zwei Häusern an der Niedergasse und der Thomästraße zusammengepfercht. Die Bewohner der Niedergasse wurden im April 1942 nach Zamosc/Belzec deportiert und die Menschen aus der Thomästraße in eine Sammelbaracke am Weslarner Weg umgesiedelt. Von hier aus folgte am 28. Juli 1942 ihre Deportation nach Theresienstadt. Soest konnte den traurigen Ruhm einer „judenfreien Stadt“ beanspruchen.
Wenige Deportierte überlebten, und noch weniger kamen zurück. Eine jüdische Gemeinde gibt es hier nicht mehr, die Zurückgekehrten schlossen sich der Kultusgemeinde Paderborn an. An die Synagoge und Schule erinnert seit 1979 eine Bronzetafel – Ausgangspunkt der besagten Gedenkveranstaltung.
Geschichtsverein und Stadt haben zur jüdischen Geschichte geforscht und Vermittlungsarbeit geleistet. Ab 2005 liegen Stolpersteine in Soest. Das Gedenken an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ist durch Straßennamen für den Reformrabbiner Levi Lazarus Hellwitz und die von den Nazis gedemütigte Sabine Rosenbaum gestärkt. Das jüdische Leben von einst ist vernichtet – aber seine Spuren müssen wir pflegen und in Erinnerung halten. Die Geschichte der Juden ist ein fester Teil unserer Stadtgeschichte.